Zur Fête de la Musique darf Berlin noch sein, was es lange gewesen ist: ein offenes Labor für Musikschaffende und -liebende. Seit Jahren ist diese Spielwiese in Gefahr. Doch unter den Musiker*innen der Stadt formiert sich Widerstand – und auch die Politik beginnt zu handeln

Es gibt Dinge, die kapiert man nicht allein. Die verbindende Macht des Techno zum Beispiel. Die Energie, die fieser, harter Punk noch immer freisetzt. Die Eleganz eines Oratoriums. Hören kann man das zu Hause. Aber es braucht andere Menschen, braucht Raum, durch den sich Musik wie in einem Energiestrahl auf uns übertragen kann, kurz: Es braucht Stadt, um Musik immer wieder anders aufzunehmen. Zur Fête de la Musique kann man das sogar an Orten tun, die sonst mit Pop oder Techno, Jazz oder Klassik wenig zu tun haben: Da spielen Bands nicht nur in Clubs, Konzerthäusern und Biergärten, sondern auch in Bibliotheken, oder, wie in diesem Jahr, im Industriesalon Schöneweide, in dem sonst historische Geräte präsentiert werden. Statt Musik unter dicken Kopfhörern zu lauschen, allein und mit verschlossenen Gesichtern, verschmelzen die Berliner*innen zur riesigen Konzertgemeinde; die Stadt verwandelt sich zum Labor für Klangwahrnehmungsforschung.
Drei Dinge mag der Musikmanager Björn Döring, Organisator und Kurator des Happenings, besonders gern: Die Fête sei ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement, ein dezentrales Alternativ-Modell zu den gängigen Festival-Varianten. „Und der dritte, mindestens ebenso wichtige Punkt ist das starke, kreative, freundliche Zeichen eines europäischen Tags der Musik“, sagt Döring.
Dass diese Party, die 1995 nach französischem Vorbild nach Berlin importiert wurde, noch immer stattfinden kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Noch vor zwei Jahren sah es schlecht aus für die Fête. Die langjährige Organisatorin Simone Hofmann hatte 2017 das Handtuch geworfen, weil sie beklagte, dass das Land die Veranstaltung nicht ausreichend unterstütze und ihr somit Finanzierungssicherheit fehle. Anfang 2018 übernahm schließlich Döring. Die Fête war gerettet. Und doch ist das Ringen um die Veranstaltung paradigmatisch für den schweren Stand, den Musiker*innen zunehmend haben. Während Berlin sein Image als Kulturstadt pflegt, geraten die lokalen Künstler*innen unter Druck, aus vielerlei Gründen: Hohe Mieten bedrohen die Existenz, der Schwund von Auftrittsorten und Proberäumen in der Stadt bringt viele Kunstschaffende zur Verzweiflung. Die lokale Musikszene, in ihrer Wildheit und Vielfalt, ist in Gefahr.
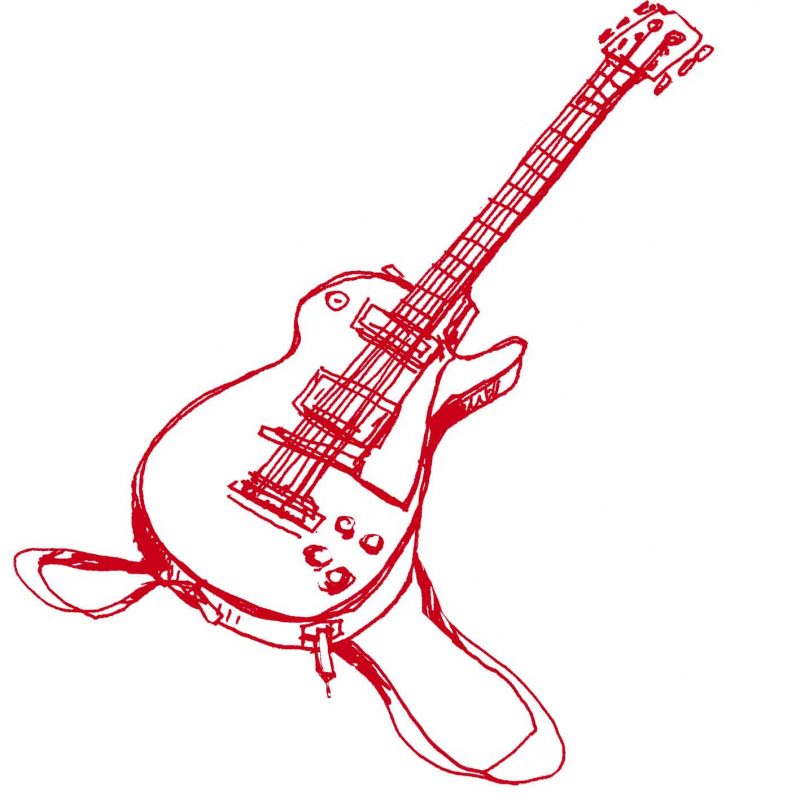
„Die Fête de la Musique ist ein schönes Event“, sagt Ran Huber. „Aber es reicht nicht, dass einmal im Jahr alle Musiker*innen auf die Straße gehen und Krach machen dürfen. So wie Kinder, deren Eltern sie eine halbe Stunde toben lassen, bevor sie wieder still sein müssen.“ Seit 20 Jahren veranstaltet Huber Konzerte der kleinen bis mittelgroßen Art. Die Künstler*innen, die bei seiner Reihe „amStart“ auftreten, spielen meist eher ungewöhnliche als Mainstream-verdächtige Musik. Huber ist einer der verdienstvollsten Indie-Veranstalter der Stadt – und ein scharfer Kritiker der Berliner Immobilienpolitik.
Huber hat dutzende Clubs aus dem Boden schießen und verschwinden sehen. Wer sich mit ihm unterhält, realisiert, wie viele Locations für Livemusik abseits von Techno, wie viele Off-Kultur-Orte für 100 bis 500 Gäste in den vergangenen Jahren geschlossen haben. Das Bassy, der Bang Bang Club, die Zentrale Randlage: alle weg. Und wenn demnächst das RAW-Gelände bebaut wird, ist auch die Zukunft des Urban Spree, in dem oft schräge, abseitige Konzerte stattfinden, ungewiss. Die Zeiten, in denen jede Woche ein anderer wilder Live-Laden eröffnet, sind lange vorbei.
Für die verlorenen Clubs der Stadt hielten Huber und seine Mitstreiter*innen kürzlich eine Séance ab. Bei der von ihm promoteten Veranstaltung „Ghost Town“ fuhren Bands wie Chuckamuck durch die Stadt und spielten an Orten, an denen sich ikonische Läden befanden. Vom früheren Club Trash am Oranienplatz zog der Tross zum ehemaligen Johnny Knüppel, zum Lovelite und nach Friedrichshain, wo einst das Antje Öklesund stand – bevor der Investor Christoph Gröner es abreißen ließ. Die Bühne befand sich auf einem Umzugswagen, der mit Pappkunstwerken geschmückt war.
„Wenn alle Clubs schließen und Freiräume verschwinden, ist das eben die Freiheit, die man sich nehmen muss: Eine Bühne auf einen Truck stellen, losfahren und Musik in den Stadtraum tragen“, sagt Huber. Auf der letzten Station, am ehemaligen Antje Ö, „vor dem bombastischen, hässlichen Gröner-Bau, der da jetzt steht – da wurde es magisch“, sagt Huber.

Vor diesem Monument der Verdrängung sang die Band Transformers „Ghost Town“ von den Specials, einen Song über die leergefegten Straßen im London der Thatcher-Ära. „Am Ende des Abends habe ich mir vorgestellt, dass wir ‘It’s The End of the World As We Know It’ von R.E.M. im Dauerloop spielen könnten, während wir mit einer Polonaise durchs Gröner-Gebäude ziehen“, sagt Huber. Haben sie dann aber doch nicht gemacht. Wäre ja Hausfriedensbruch gewesen. Aber eigentlich, glaubt Huber, müsse man doch genau das öfter tun: subversiv sein. „Von Seiten der Politik wird immer viel guter Wille in Richtung Kulturszene geäußert. Aber die Politiker*innen sind viel zu stark in ihrer eigenen Realität gefangen. Und diese Realität heißt: Berlin wird verkauft“, sagt er. „Es wäre schön, wenn Politiker so radikal sein dürften wie Greta Thunberg. Mit der aktuell beschlossenen Mietdeckelung und der Idee, die Mieten fünf Jahre lang einzufrieren, kommen sie dem immerhin nah.“
Kompromisslos sein also. Ein Symbol für den erwachenden Kampfgeist der Berliner Musikszene steht wie ein Monolith in einer Seitenstraße der Frankfurter Allee: Das Rockhaus, ein ehemaliges DDR-Bürogebäude in Lichtenberg, ist seit 2007 einer von Berlins größten Übungsraumkomplexen. Hier proben Profimusiker*innen, die mit Acts wie Bosse auf Tour gehen, aber auch Bands aller Genres: von der Streetcore-Truppe Toxpack bis zum Garage-Trio Snøffeltøffs. Wer einen Blick in die Proberäume erhascht, sieht mal Kabelgewirr, mal überquellende Aschenbecher und leere Flaschen. Rock’n’Roll auf wenigen Quadratmetern. Am Kiosk im Erdgeschoss, der Nützliches wie Plektren, Gitarrensaiten und Bier verkauft, stehen langhaarige Kerle und prosten einander zu.
„Kunst statt Kohle!“
Bis vor wenigen Wochen war das Rockhaus in Gefahr: Mitte März hatte der Rockhaus-Betreiber Dirk Kümmele den Mieter*innen mitgeteilt, dass sie ihren Proberaum zum 31. Mai verlassen müssten. Kurz darauf wurden die Räume des Rockhauses als Büros auf Immobilienscout24.de angeboten. Der Grund: Schon länger gab es Ärger zwischen Kümmele und dem Investor Shai Scharfstein, der das Gebäude 2015 gekauft hatte. Vor drei Jahren kündigte die Scharfstein Group dem Betreiber fristlos, als Begründung gab man Mängel beim Brandschutz an. Doch hinter den Kulissen soll der Streit weitergegangen sein. Kümmele schmiss hin.
Unter den Mieter*innen formierte sich Widerstand. Lange waren sie kaum vernetzt gewesen – das änderte sich. Ein Transparent, das sie nachts an der Fassade des Gebäudes entrollt hatten, wurde zum Widerstandssymbol: „Wir bleiben im Rockhaus! Kunst statt Kohle!“, stand da schwarz auf weißem Stoff. Die Verzweiflung trieb die Küstler*innen zum Protest, denn die Proberaum-Situation in Berlin ist mehr als prekär. Das Rockhaus beherbergt 186 Übungsräume, genutzt von rund 1.000 Musiker*innen.

Zwar gibt es noch Übungsräume in Berlin, etwa im Marzahner Orwo-Haus. Aber die Wartelisten sind lang, die Räume oft unerschwinglich für kleine Acts. Und seit der Musikbunker in Tempelhof mit seinen 47 Räumen geschlossen ist, hat sich die Lage zusätzlich verschärft. Der Eigentümer des Komplexes hatte den Mieter*innen am 29. März dieses Jahres fristlos gekündigt. Der Grund: wieder mal Mängel beim Brandschutz. Rund 100 Bands standen auf der Straße. Ihre Szene zu unterstützen, hat die Stadt lange verschlafen: In ganz Berlin gibt es übrigens nur 17 landeseigene Übungsräume. Und keinen Proberaum zu haben, bedeutet vor allem für kleine Bands nicht selten das Ende.
Nachdem die Rockhaus-Kündigung bekannt wurde, rief man Mieterversammlungen ins Leben, startete eine Online-Petition. Bald schalteten sich das Musicboard, die senatseigene Fördereinrichtung für Popkultur, und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ein, um mit der Scharfstein Group nach einer Lösung zu suchen. Katja Lucker, Geschäftsführerin des Musicboards, hatte das Rockhaus schon 2017 unterstützt. Auch diesmal habe sie die Scharfstein Group gebeten, die Musiker*innen nicht rauszuwerfen, sagt sie. Sie ackerte wochenlang für den Proberaumkomplex.
Ende Mai erzielten Lederer und der Eigentümer schließlich eine Einigung: Das Rockhaus soll für weitere 20 Jahre bleiben. An Stelle des scheidenden Betreibers Kümmele soll das Land Berlin in den Mietvertrag einsteigen – über die Gesellschaft für Stadtentwicklung (GSE), die fortan für die Verwaltung des Rockhauses zuständig ist. Was sich für die Künstler*innen ändert, ist die Miete: Bislang waren die Räume für etwa 10 Euro pro Quadratmeter zu haben, ein Luxus in Berlin. Künftig werden sie um die 15 Euro zahlen müssen. Ein Preis, der nur zustande kommt, weil das Land Berlin 2,50 Euro pro Quadratmeter dazugibt – und der nur bis Ende 2020 gilt. Danach wird es eine Staffelmiete geben. Ein Wermutstropfen für viele Mieter*innen, aber immerhin.
„In Berlin findest du keinen Proberaumkomplex, der so gut organisiert ist wie das Rockhaus“, sagt Julian von den Snøffeltøffs. „Es ist sauber, die Räume haben eine hohe Qualität, am Kiosk ist das Bier sogar günstiger als beim Späti.“ Auch Isolation Berlin, die mittlerweile sogar in Asien touren, probten von 2013 bis 2016 im Rockhaus. Vorher, erzählt Schlagzeuger Simeon Cöster am Telefon, hätten sie in einem „verschimmelten Keller“ an der Beusselstraße geübt: „Da gab es Ratten, aber es war trotzdem teurer als Wohnraum.“ Aktuell sind auch sie wieder auf der Suche nach einem Übungsraum mit integriertem Studio. Der Proberaum-Mangel in Berlin betrifft alle: Indie-Topseller und aufstrebende Gruppen, Schülerbands und Profimusiker*innen. Zwar gibt es immer mehr Proberäume, die man stundenweise mieten kann – aber Preise ab zwölf Euro pro Stunde sind für Musiker*innen, die jeden Tag üben müssen, nicht zu stemmen. Florian von den Snøffeltøffs sieht das Konzept auch aus einem anderen Grund kritisch: „Du kannst dich nicht entwickeln. Der Prozess des Kunstschaffens fällt weg, wenn du dich als Band nicht mal für eine Woche einschließen darfst.“
Auch Kitty Solaris probt im Rockhaus. Wäre die Kündigung gekommen, sie hätte nicht gewusst, wohin mit ihrem Equipment. „Es war ein ewiges Hin und Her, und auch jetzt ist noch nicht so richtig klar, wie es weitergeht”, sagt sie. Die befreundete Gruppe Pari Pari, die bei Solaris’ Label Solaris Empire unter Vertrag ist, hat ihren Proberaum im Rockhaus im Zuge der drohenden Schließung geräumt. Nun sucht Solaris eine Band, mit der sie sich den Proberaum und somit auch die Miete teilen kann.
Solaris, die eigentlich Kirsten Hahn heißt, ist seit 20 Jahren eine Konstante im Berliner Underground, nicht nur als Musikerin und Labelmacherin. Sie veranstaltet Shows, meist im Schokoladen in Mitte. Dass sie dort noch Rock-Konzerte ausrichten kann, sei ein Glück, sagt Solaris. Immer weniger Lokale würden „Door-Deals“ anbieten, lassen sich also ohne hohe Abendmiete nutzen, während Band und Veranstalter*in die Einnahmen unter sich aufteilen. Dazu komme ein anderes Problem: „Es gibt viele Locations, in denen Singer-Songwriter mit Gitarre auftreten können. Aber Bands mit Schlagzeug haben es zunehmend schwer – wegen der Lärmbeschwerden.“
Der ewige Konflikt: Party vs. Anwohner
Der Konflikt „Anwohner*innen versus Musikszene“ ist ein wunder Punkt in Berlin. Das bringt Clubs in Bedrängnis – aber eben auch die Open-Air-Szene, vom kleinen Rave bis zu Großevents wie der Fête de la Musique. Zwei geplante Verordnungen hatten im Frühjahr für Aufsehen gesorgt. In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung kursierte die Idee, dass künftig jede Veranstaltung mit mehr als 200 Besucher*innen rechtzeitig bei der Baubehörde des zuständigen Bezirks angemeldet werden müsse – aus Brandschutzgründen. Viele fürchteten: Veranstalter*innen mit wenigen Ressourcen würde der dafür nötige bürokratische Aufwand das Leben schwer machen. Doch das scheint vom Tisch: Die Senatsverwaltung habe von der Verordnung Abstand genommen, erklärt die Pressestelle auf Anfrage des tip.
Zum anderen wurde vor Kurzem bekannt, dass Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für die Grünen) an einer Novellierung der Veranstaltungslärm-Verordnung arbeite. Die würde mit sich bringen, dass Partys und Konzerte im Freien, die länger als fünf Stunden dauern, strengeren Lärmschutzauflagen unterliegen. „Über Details einer künftigen Veranstaltungslärm-Verordnung ist noch nicht abschließend entschieden“, sagt Pressesprecher Jan Thomsen. „Was bisher bekannt wurde, sind allenfalls Bruchstücke interner fachlicher Überlegungen.“ Das Argument vieler Regulierungswilliger: Die Stadt werde immer lauter, und nicht alle in der Stadt seien Partygänger*innen.
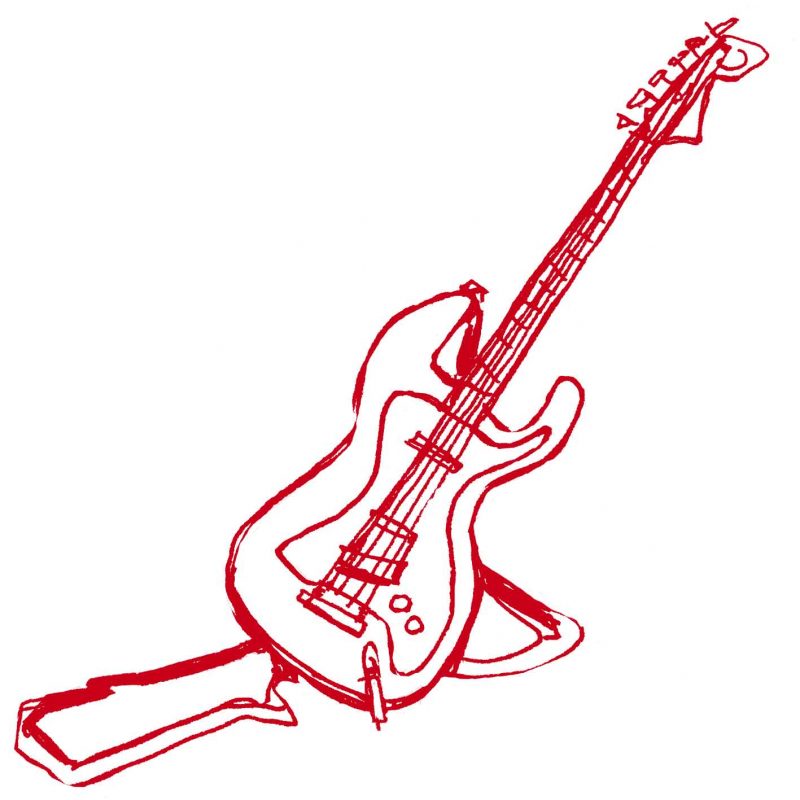
„Dass in Berlin immer mehr Open-Air-Veranstaltungen stattfinden, ist eine gefühlte Wahrnehmung. Ob das wirklich so stimmt, können nicht einmal die Ämter beantworten, es gibt ja keine Statistiken dazu“, sagt Lutz Leichsenring, Sprecher der Clubcommission, der Interessenvertretung der Berliner Clubs. „Wenn heute Open Airs stattfinden, ist ja schon alles durchreguliert, die Anlagen sind eingepegelt.“ Das Hauptproblem: „Zwischen Anwohner*innen, die sich wegen Lärm beschweren, und Verwaltung fehlt eine vermittelnde Instanz.“ Die Clubcommission, sagt Leichsenring, könnte dieser Vermittler sein.
Eine Maßnahme der Kommission ist ein gemeinsames Monitoring-Projekt mit der TU Berlin im Bereich zwischen Jannowitz- und Schillingbrücke. Gibt es Lärmbeschwerden, hat die Verwaltung die Möglichkeit, dieses Monitoring abzurufen. Expert*innen analysieren dann, wo konkret Lärm entsteht – ob am Spätkauf, Club oder U-Bahn-Ausgang – und welche Art von Krach da die Anwohner*innen stört: Verkehr, Bässe oder Sprechgeräusche. Die Expert*innen erstellen daraufhin konkrete Handlungsempfehlungen. Ziel des Ganzen: Kein flächendeckendes Verbot von lauter Musik, sondern punktuelle Lösungen bei Lärm. „Die Verwaltung ist überfordert, das ist verständlich. Aber Regulierungen treffen oft die Falschen, oder es gibt Kollateralschäden“, sagt Leichsenring. „Das Ruhebedürfnis der Anwohner*innen und den Wunsch, das Besondere an Berlin zu erhalten, kriegt man nicht in Einklang, indem man alles durchreguliert.“
Die Arbeit von Institutionen wie Clubcommission und Musicboard zeigt: In Berlin beginnt die Politik zu verstehen, dass sie sich für ihre Kunstschaffenden, für ihre Open-Air- und Konzertkultur einsetzen muss. Aber, das sagen Musiker*innen ebenso wie auch Veranstalter Ran Huber: Förderung ist gut, aber sie bekämpft lediglich die Symptome. Nur ein Richtungswechsel in der Mieten- und Immobilienpolitik könne die Situation für Musiker*innen langfristig verbessern. Vielleicht merkt man bei der Fête de la Musique, ob beim Balkan-Pop-Konzert in der Gartenkolonie oder Raves unter freiem Himmel: Ohne laute Musik, hin und wieder, würde uns etwas fehlen.




